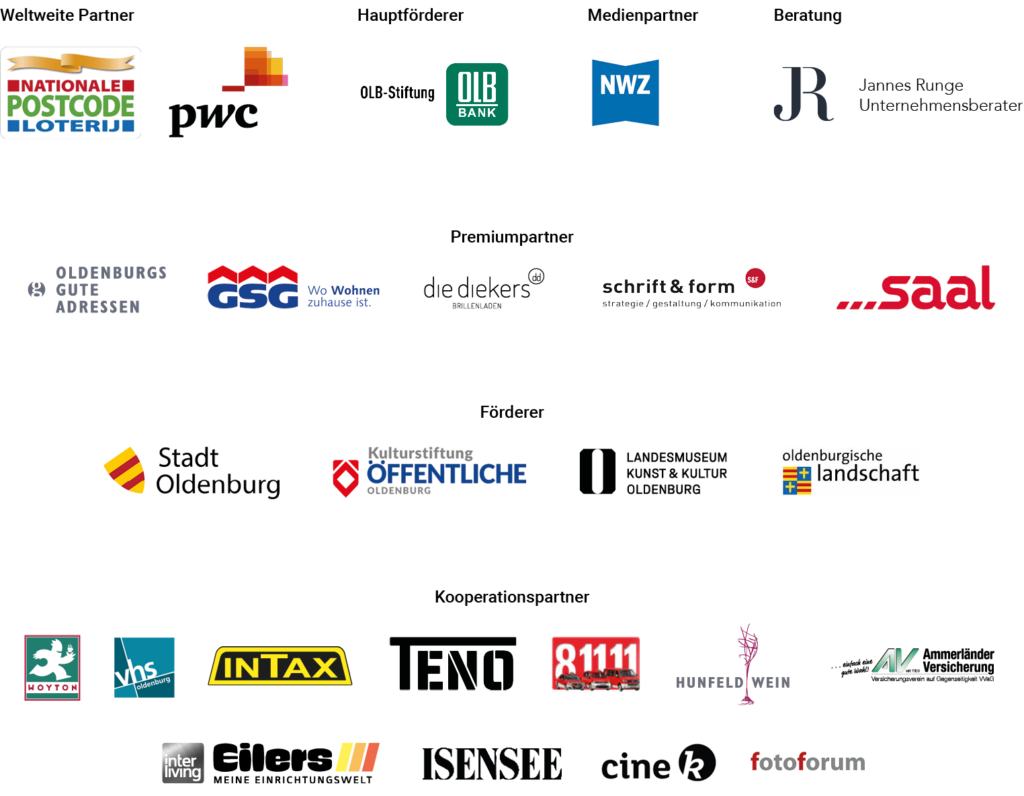Zu Beginn der Corona-Pandemie im Frühjahr 2020 fotografierte Roland Schmid Paare, Freunde und Familien, die sich an den geschlossenen Grenzen zwischen Deutschland und der Schweiz trafen. Für sein Projekt „Cross-Border Love“ belegte der Krisenfotograf im aktuellen World-Press-Photo-Wettbewerb den zweiten Platz in der Kategorie „Reportagen“. Im Interview verrät er, welche sonderbaren Szenen sich an den Grenzen abspielten und was sein Interesse für Osteuropa mit einer unplanmäßigen Zwischenlandung zu tun hat.

Herr Schmid, wussten Sie schon immer, dass Sie einmal Fotograf werden möchten?
Ja, das war mir schon früh klar. Mit acht Jahren wurde mir von meiner Großmutter eine Boxkamera geschenkt. Das faszinierte mich von Anfang an. Erst relativ spät fing ich dann an, intensiver zu fotografieren. Mein damaliger Englischlehrer war ein sehr guter Fotograf und hat mir Vieles gezeigt. Seitdem hat mich die Fotografie nicht mehr losgelassen,
Wie sind Sie auf Krisenfotografie gekommen?
Das hat sich mit der Zeit einfach so ergeben. Ich habe mich schon immer stark für Osteuropa interessiert und war dort viel unterwegs. Da kam ich nicht umhin, mich auch mit den Krisen dort zu beschäftigen. Ich war zum Beispiel in der Tschechoslowakei, als die Slowakei sich abspaltete. Mittlerweile reise ich seit über 30 Jahren regelmäßig nach Osteuropa, um die Situation vor Ort zu dokumentieren.
Warum gerade Osteuropa?
Mein erster Berührungspunkt mit Osteuropa war völlig ungeplant. Wir wollten nach Griechenland fliegen, doch unser Flugzeug musste in Bukarest zwischenlanden. So durften wir notgedrungen einige Tage dort verbringen. Es war eine völlig unbekannte Welt, in die ich da hineingeworfen wurde. Die Gerüche, die Farben … alles hat mich fasziniert. Zu dem Zeitpunkt gab es noch den eisernen Vorhang, ich war gerade einmal 18 Jahre alt. Später reiste ich dann mit meinem damaligen Englischlehrer, mit dem ich mich angefreundet hatte, einige Male in seine Heimat Tschechien. Der Osten hat mich irgendwann einfach nicht mehr losgelassen. Das brachte mich schließlich von einer Geschichte zur nächsten.

Mit Ihrem Projekt „Cross-Border Love“ belegten Sie den zweiten Platz beim World-Press-Photo-Wettbewerb in der Kategorie „Reportagen“. Wie ist die Idee dafür entstanden?
Als die Coronakrise begann, kam ich gerade aus der Ukraine zurück. Meine Arbeit, die ich dort gemacht hatte, konnte ich nicht mehr verkaufen. Als dann in der Schweiz der erste Lockdown kam, fand ich auf einmal eine Krise direkt vor der eigenen Haustür vor. „Da lässt sich fotografisch bestimmt etwas draus machen“, dachte ich mir. Also fotografierte ich zunächst die leere Stadt, wie viele andere auch. Als die Grenzen geschlossen wurden, fing ich an, Grenzbarrikaden als Motive zu nutzen. In den Nachrichten sah ich schließlich, dass sich bei Basel ein Liebespaar an der Grenze trifft. Ich war der Meinung, dass das einen interessanten Aspekt der Coronakrise zeigte, und wollte ihn festhalten.
Wie sah die konkrete Arbeit an Ihrem Projekt aus?
Zunächst machte ich einige Spaziergänge in Basel. Da fand ich an den Grenzen dann tatsächlich überall Menschen vor, die sich trafen: Paare, getrennte Familien und Freunde. Ich sprach sie einfach an, ob es in Ordnung wäre, wenn ich sie fotografiere, und die meisten stellten sich gerne zur Verfügung. Außerdem bin ich zweimal nach Kreuzlingen gefahren, um an der Grenze zu Konstanz zu fotografieren. Da ich mich dort nicht so gut auskannte, recherchierte ich im Voraus, wo genau sich die Grenzen befinden und vor welchem geschichtlichen Hintergrund sie entstanden waren. Insgesamt flossen einige Tage Arbeit in das Projekt.

Wie war die Stimmung an den Grenzen?
Die Stimmung war ausgelassen. Ich glaube die Leute waren einfach froh, dass sie sich treffen konnten. Ein Kollege von mir fotografierte einmal ein Streichquartett, das gerade probte: einer auf der einen, die anderen drei auf der anderen Seite. Andere spielten über die Grenze hinweg Federball. Es waren wirklich skurrile Szenen, aber überall herrschte eine unglaublich positive Stimmung.
Wie ging es dann weiter mit Ihren Fotos?
Ich fing an, die Fotos auf meinen Instagram-Account zu stellen. Danach kamen bald die ersten Anrufe von Lokalredaktionen, die die Bilder veröffentlichen wollten. Irgendwann bot ich die Geschichte auch auf internationaler Ebene an – und tatsächlich druckte der Guardian sie ab! Als der Artikel veröffentlicht war, brach eine Lawine los. Noch mehr Schweizer Medien riefen an und wollten die Bilder haben. Damit wurde das Projekt zum Selbstläufer. Kollegen ermutigten mich irgendwann dazu, meine Fotos für den World-Press-Photo-Wettbewerb einzureichen. Große Erwartungen hatte ich nicht, aber ich dachte mir: Probieren schadet ja nicht.

Und es hat sich gelohnt! Haben Sie denn ein Lieblingsfoto aus Ihrem Projekt?
Ja, das ist das Bild von einem Pärchen, das auf einer Decke unter einem Baum liegt, zwischen ihnen ein Plastikband. Die Frau kam aus der Gegend von Basel und der Mann war drei, vier Stunden aus Deutschland angereist. Als ich sie fragte, ob ich sie fotografieren darf, rief die Frau sofort: „Ja, auf jeden Fall! Das muss man doch dokumentieren!“ Mit einem Filzstift hatten sie sogar auf der Decke die Grenze markiert.
Gibt es eine Botschaft, die Sie mit Ihrem Projekt vermitteln wollen?
Offene Grenzen sind ein unglaublicher Luxus. Dort, wo ich normalerweise für meine Arbeit hinreise, herrschen ganz andere Zustände. Wir in Mitteleuropa sind uns unseres Privilegs oft gar nicht mehr bewusst. Grenzen sind für uns nicht mehr spürbar, wir können sie einfach überqueren. Wir sollten nicht vergessen, wie wichtig das ist, und Sorge dafür tragen, dass dieser Zustand auch beibehalten wird.
Interview: Jessica Foppe